KI in der Psychotherapie - Was bedeutet das für die Praxis?
Fachlich geprüft von
Inês Lopes
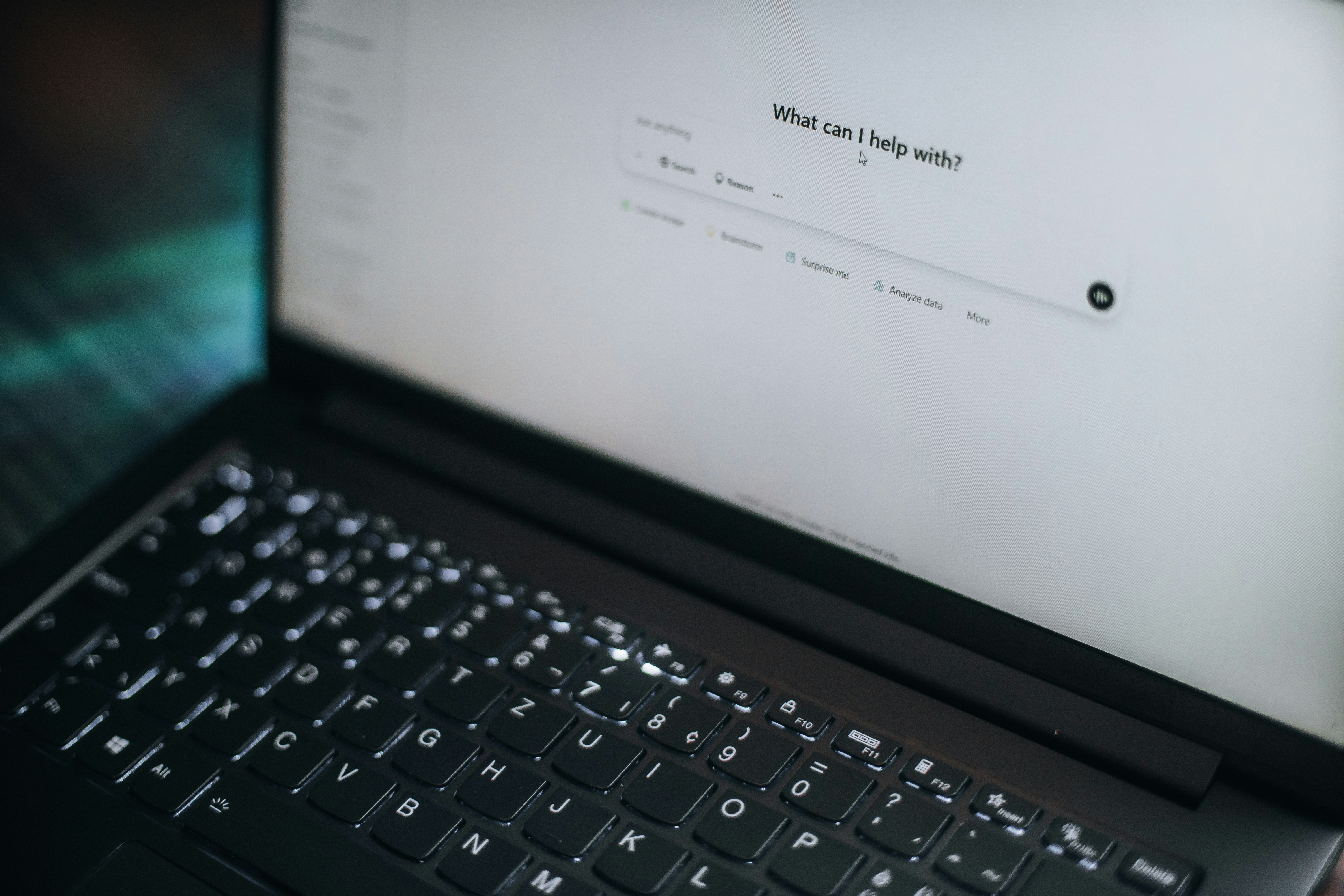
Die Diskussion rund um Künstliche Intelligenz (KI) macht auch vor der Psychotherapie nicht Halt. Immer häufiger berichten Patient:innen, dass sie ihre Symptome, Diagnosen oder sogar Therapieansätze mithilfe von Chatbots wie ChatGPT recherchiert haben, bevor sie in die Praxis kommen. Manche erscheinen bereits mit „fertigen“ Hypothesen, andere bringen komplexe Informationen mit, die sie online generiert haben. Für Psychotherapeut:innen kann das sowohl eine Herausforderung als auch eine Chance sein: Wie lässt sich eine professionelle Haltung dazu entwickeln? Welche Rolle spielt die Patient:innenkompetenz in Zeiten von KI? Und wie gelingt es, die therapeutische Beziehung nicht zu gefährden, sondern durch den Umgang mit KI sogar zu stärken?
In diesem Artikel möchten wir Psychotherapeut:innen eine Hilfestellung geben, um souverän und reflektiert mit Patient:innen umzugehen, die KI-generierte Diagnosen oder Therapieideen in die Behandlung einbringen.
Patient:innenkompetenz im digitalen Zeitalter
Patient:innen sind heute informierter als je zuvor. Neben klassischem„Dr. Google“ treten nun KI-gestützte Systeme, die auf Nachfrage ganze Erklärungen, Therapieempfehlungen oder vermeintliche Diagnosen liefern. Für viele Patient:innen bedeutet das ein Gefühl von Selbstermächtigung: Endlich verstehen sie ihre Symptome besser, können Fachbegriffe einordnen und haben das Gefühl, aktiv an ihrer Gesundheit mitzuarbeiten.
Dieser Trend hat zwei Seiten. Einerseits können gut informierte Patient:innen die Therapie aktiv mitgestalten, Fragen stellen und besser verstehen, warum bestimmte Interventionen hilfreich sind. Andererseits besteht die Gefahr, dass KI-gestützte Inhalte falsch, unvollständig oder schlichtweg irreführend sind.
Typische Situationen in der Praxis
- Die Patientin mit einer „KI-Diagnose“: Sie hat Symptome in einen Chatbot eingegeben und kommt z.B. mit dem Ausdruck „Generalisierte Angststörung“ in die Sitzung.
- Der Patient mit Therapieempfehlungen: Er bringt eine Liste an Techniken mit, die ChatGPT vorgeschlagen hat, und fragt, ob diese nicht schneller zum Ziel führen.
- Die verunsicherte Person: Sie liest widersprüchliche Informationen, fühlt sich von der KI „anders diagnostiziert“ und fragt sich, ob die eigene Psyche überhaupt noch vertrauenswürdig ist.
All diese Szenarien zeigen, dass KI in der Psychotherapie-Praxis kein Zukunftsthema mehr ist, sondern Alltag sein kann.
Chancen durch KI-Nutzung von Patient:innen
- Stärkung der Partizipation: Patient:innen fühlen sich ernst genommen, wenn ihre eigenen Recherchen in die Therapie integriert werden.
- Motivation und Selbstwirksamkeit: Wer sich aktiv informiert, zeigt Eigeninitiative, ein wertvoller Faktor im therapeutischen Prozess.
- Brücke zur Psychoedukation: KI kann ein Einstieg sein, um über Krankheitsbilder, Symptome und Behandlungsmethoden aufzuklären.
Risiken und Grenzen
- Fehlinformationen: KI-Modelle sind nicht unfehlbar und können falsche Diagnosen liefern.
- Verlust der therapeutischen Kompetenz: Wenn Patient:innen KI als gleichwertig oder überlegen betrachten, kann das die Zusammenarbeit erschweren.
- Überforderung: Zu viele Informationen können Patient:innen verunsichern und Symptome verstärken.
Haltung entwickeln: Leitlinien für Psychotherapeut:innen
Um souverän mit KI-basierten Patient:inneninformationen umzugehen, kann es hilfreich sein, folgende Haltung einzunehmen:
1. Offenheit zeigen
Patient:innen ohne Abwehrhaltung begegnen. Wenn jemand KI-Recherchen mitbringt, ist das Ausdruck von Interesse und Selbstfürsorge. Eine wertschätzende Reaktion fördert das Vertrauen in der Beziehung.
2. Einordnen statt abwerten
Statt Aussagen wie „Das stimmt so nicht“ ist es hilfreicher, die Inhalte gemeinsam zu prüfen: „Spannend, dass Sie das recherchiert haben. Lassen Sie uns anschauen, wie das zu Ihrer individuellen Situation passt.“
3. Kompetenz vermitteln
Transparent machen, wo KI an ihre Grenzen stößt. Diagnosen können nur durch eine umfassende klinische Einschätzung gestellt werden, nicht durch eine KI, die keine Kontextinformationen hat oder Beobachtungen miteinbringen kann.
4. Patient:innenkompetenz fördern
Patient:innen ermutigen, Fragen zu stellen, Informationen kritisch zu hinterfragen und gemeinsam Quellen zu bewerten. So wird aus potenzieller Verunsicherung ein Lernprozess.
5. Therapeutische Beziehung stärken
Der Umgang mit KI-Inhalten kann eingemeinsames Thema in der Beziehung werden. Wie gehen wir mit Unsicherheiten um? Wie unterscheiden wir valide Informationen von Halbwissen?
Praktische Strategien für den Alltag
- Fragen stellen: „Was hat Sie motiviert, das nachzulesen?“ oder „Wie haben Sie die Informationen empfunden?“
- Psychoedukation nutzen: Patient:innen über die Funktionsweise von KI aufklären (z. B. dass ChatGPT Informationen aus dem Internet verarbeitet und dabei die Quellen nicht auf Richtigkeit prüft.).
- Struktur geben: Verdeutlichen welche Informationen für die aktuelleTherapiephase relevant sind – und welche eher ablenken.
- Ressourcenorientierung: Die Stärke der Patient:innen betonen, sich mit ihrer Gesundheit auseinanderzusetzen.
Ethische Fragen und Verantwortung
Psychotherapeut:innen stehen zudem vor der Aufgabe, ethische Aspekte zu reflektieren:
- Welche Rolle spielt Datensicherheit bei der Nutzung von KI?
- Wie verhindern wir, dass KI-Antworten therapeutische Entscheidungen dominieren?
- Wie können wir Patient:innen dazu ermutigen, seriöse Quellen von spekulativen Inhalten zu unterscheiden?
Ein professioneller Umgang bedeutet nicht, KI grundsätzlich abzulehnen, sondern eine klare Grenze zwischen unterstützender Information und klinisch bedeutsamen Entscheidung zu ziehen.
Abschluss
KI in der Psychotherapie ist kein Störfaktor, sondern ein neues Element im therapeutischen Alltag. Patient:innenkompetenz zeigt sich heute auch darin, digitale Hilfsmittel zu nutzen. Für Psychotherapeut:innen bedeutet das, ihre Haltung anzupassen: Offen, einordnend und ressourcenorientiert. Statt KI als Konkurrenz zu sehen, kann sie zur Brücke werden, hin zu mehr Partizipation, Selbstwirksamkeit und einer gestärkten therapeutischen Beziehung.
Entscheidend bleibt: Die psychotherapeutische Expertise, die Beziehungsgestaltung und die individuelle klinische Einschätzung sind durch keine Maschine ersetzbar. KI kann unterstützen, aber die menschliche Begegnung ist und bleibt das Herzstück der Psychotherapie.


