Performativeness in sozialen Medien: Wenn das Leben zur Bühne wird
Fachlich geprüft von
Inês Lopes
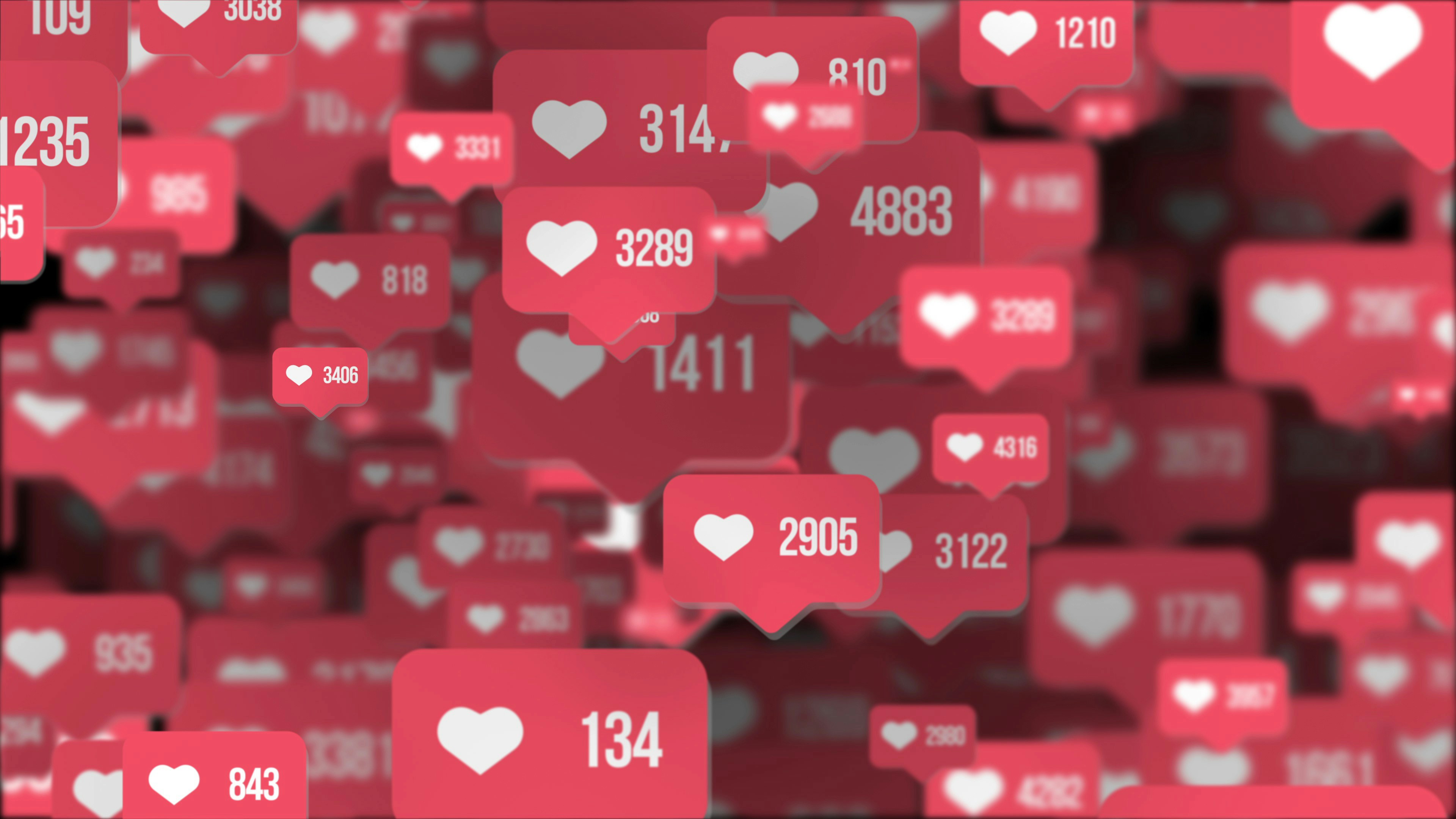
In sozialen Medien ist der Begriff Performativeness immer häufiger zu sehen. Gemeint ist ein Phänomen, das viele Menschen kennen, auch ohne den Fachausdruck zu benutzen: Das eigene Leben fühlt sich weniger gelebt und mehr gespielt an – wie auf einer Bühne, vor einer unsichtbaren Zuschauer:innenschaft.
Ob politisches Engagement, Klimaschutz, Körperoptimierung, mentale Gesundheit oder „good vibes only“: Überall scheint ein stiller Druck mitzuschwingen, nach außen „richtig“ zu wirken. Richtig engagiert, richtig reflektiert, richtig glücklich, richtig „woke“.
Performativeness beschreibt in der Psychologie genau diese Tendenz: Handlungen, Gefühle oder Haltungen werden vor allem gezeigt, um nach außen einen bestimmten Eindruck zu erzeugen – weniger, weil sie innerlich wirklich so erlebt werden. Es geht um Anerkennung, Likes und Zugehörigkeit. Damit berührt Performativeness zentrale Themen von Authentizität, Selbstwertgefühl und psychischer Gesundheit in einer digital vermittelten Welt.
Was steckt psychologisch hinter Performativeness?
Es geht um eine Verschiebung der Motivation: Nicht das innere Erleben steht im Vordergrund, sondern die erwartete Reaktion eines Publikums – real oder nur vorgestellt.
Typische Merkmale von Performativeness sind:
- Fokus auf externe Bestätigung: Handlungen werden stark davon beeinflusst, wie andere darauf reagieren.
- Inauthentizität: Zwischen Außenbild und innerem Erleben entsteht eine Lücke.
- Selbstinszenierung: Der Alltag wird zur Bühne, das eigene Ich zur Rolle.
Performativeness bedeutet nicht automatisch Lüge oder Täuschung. Menschen spielen in verschiedenen Kontexten unterschiedliche Rollen – als Kolleg:in, Freund:in, Elternteil, Aktivist:in. Problematisch wird es, wenn die Performance wichtiger wird als die innere Stimmigkeit und wenn ständiges „Gesehenwerden“ auf Kosten der mentalen Gesundheit geht.
Soziale Medien als Verstärker von Performativeness
Performativeness existierte schon vor Instagram, TikTok oder LinkedIn. Doch soziale Medien verstärken das Phänomen deutlich:
- Das eigene Auftreten ist ständig sichtbar, vergleichbar und bewertbar.
- Algorithmen belohnen Zuspitzung, Emotionen und klare Botschaften – während das echte Leben oft komplex und widersprüchlich ist.
- Inhalte, die Erfolg, Optimismus oder moralische Klarheit zeigen, erhalten meist mehr Aufmerksamkeit als Unsicherheit oder Ambivalenz.
Dadurch entstehen typische Formen von Performativeness in sozialen Medien:
- Performative Positivität: Dauerhafte gute Laune wird inszeniert, auch wenn innerlich Erschöpfung oder Traurigkeit vorherrschen.
- Performativer Aktivismus: Hashtags, Statements oder Bilder signalisieren Solidarität, ohne dass sich im Alltag viel verändert.
- Performative Achtsamkeit & Selfcare: Yoga, Journaling oder Meditation erscheinen eher als Lifestyle-Marke denn als ernst gemeinte Selbstfürsorge.
Gerade im Bereich psychische Gesundheit ist das ambivalent: Offene Posts zu Depression, Angst oder Burnout können entstigmatisieren – gleichzeitig kann ein subtiler Druck entstehen, „richtige“ Betroffenheit und „richtige“ Heilung zu inszenieren.
Psychologische Wurzeln: Selbstwertgefühl, Zugehörigkeit und soziale Lernerfahrungen
Performativeness ist kein Zeichen persönlicher Schwäche, sondern lässt sich psychologisch gut einordnen. Mehrere Bausteine greifen ineinander:
Bedürfnis nach Zugehörigkeit
Menschen sind soziale Wesen. Das Bedürfnis, dazuzugehören, ist tief verankert. In unsicheren oder polarisierenden Zeiten kann der Wunsch, „auf der richtigen Seite“ zu stehen, besonders stark werden. Performativeness kann dann wie eine Strategie wirken, soziale Sicherheit zu schaffen – auch um den Preis innerer Spannung.
Selbstwert und Unsicherheit
Ein fragiles Selbstwertgefühl führt häufig dazu, dass Anerkennung von außen wie eine schnelle Stabilisierung wirkt. Likes, Kommentare und positive Rückmeldungen können sich anfühlen wie ein psychischer „Boost“. Die Kehrseite: Der Wert der eigenen Person hängt immer stärker von Reaktionen anderer ab.
Soziales Lernen und Belohnung
Durch soziales Lernen werden Verhaltensmuster übernommen, die sichtbar belohnt werden. Wer beobachtet, dass bestimmte Formen von performativer Positivität oder performativem Aktivismus viele Follower, Kooperationen oder Anerkennung bringen, ist eher bereit, diese Muster zu imitieren. So verstärken sich bestimmte „Erfolgsformeln“ der Selbstinszenierung.
Gesellschaftliche Narrative
Leistungsorientierung, Selbstoptimierung und Influencer-Kultur transportieren die Botschaft: „Sei sichtbar, sei besonders, sei immer ein bisschen besser.“ Das kann den Eindruck verstärken, der eigene Wert hänge davon ab, wie konsequent eine bestimmte Rolle nach außen gezeigt wird – etwa die der starken Person, der reflektierten Person oder der dauerhaft produktiven Person.
Typische Formen von Performativeness: Aktivismus, Positivität und Emotionen
In der öffentlichen Debatte tauchen einige Formen von Performativeness besonders häufig auf:
Performativer Aktivismus
Unter performativem Aktivismus werden Handlungen verstanden, die vor allem symbolisch sind: das Teilen von Hashtags, das Posten von Statements oder die Teilnahme an Online-Kampagnen, ohne dass sich im Alltag viel verändert.
Solche Gesten können sinnvoll sein – sie machen Themen sichtbar und signalisieren Zugehörigkeit zu bestimmten Werten. Gleichzeitig entsteht schnell eine Dynamik, in der das Signal nach außen wichtiger wird als die verinnerlichte Haltung.
Performative Positivität und toxischer Optimismus
Performative Positivität beschreibt das Bedürfnis, immer optimistisch, dankbar und „good vibe“ zu wirken. Belastende Gefühle wie Trauer, Wut oder Angst werden dabei oft ausgeblendet. In Verbindung mit sozialen Medien kann das zu einem Klima führen, in dem negative Emotionen als persönliches Versagen gelten – mit Folgen für die psychische Gesundheit.
Performative Emotionalität
Auch Emotionen selbst können performativ werden: Tränen im Livestream, dramatische Bekenntnisse oder „Therapy Talk“ mit psychologischen Fachbegriffen. Es ist oft schwer zu unterscheiden, wo authentischer Ausdruck endet und strategische Selbstinszenierung beginnt. Problematisch wird es, wenn Emotionen vor allem als Content verstanden werden und weniger als innere Signale, die ernst genommen werden wollen.
Performativeness und psychische Gesundheit
Kurzfristig kann Performativeness Vorteile bringen: soziale Anerkennung, Zugehörigkeit, möglicherweise berufliche Chancen. Langfristig zeigen sich jedoch Risiken für die mentale Gesundheit:
- Innere Entfremdung: Wenn das Außenbild immer stärker vom inneren Erleben abweicht, kann ein Gefühl von Leere oder Unwirklichkeit entstehen.
- Scham und Selbstzweifel: Das Wissen, manchmal nicht ganz authentisch zu handeln, kann zu Selbstabwertung führen. Begriffe wie „Impostor“ beschreiben diesen inneren Konflikt.
- Dauerhafter Stress: Ständiges „In-Form-Sein“ für eine reale oder imaginierte Öffentlichkeit erzeugt psychische Daueranspannung.
- Verlust von Intimität: Je mehr Lebensbereiche zur Performance werden, desto weniger Raum bleibt für widersprüchliche, unperfekte, verletzliche Seiten – genau jene, die tiefe Beziehungen oft erst möglich machen.
Auch in der digitalen psychologischen Diagnostik spielt Authentizität eine Rolle: Online-Screenings und digitale Tests können nur dann ein realistisches Bild der psychischen Situation liefern, wenn Antworten nicht primär performativ gefärbt sind, sondern möglichst ehrlich das innere Erleben widerspiegeln.
Wege zu mehr Authentizität im digitalen Alltag
Performativeness wird in Diskussionen oft abwertend verwendet. Psychologisch betrachtet lohnt sich ein differenzierter Blick: Häufig handelt es sich um Anpassungsstrategien in einer stark bewertenden Umwelt. Statt moralischer Verurteilung kann der Fokus auf Selbstmitgefühl und Entwicklung liegen.
Mögliche Ansatzpunkte sind:
- Ambivalenz akzeptieren: Viele Handlungen sind gleichzeitig authentisch und performativ. Echte Betroffenheit und das Wissen um soziale Anerkennung können nebeneinander bestehen.
- Private Räume stärken: Beziehungen, in denen Zweifel, Widerspruch und Schwäche Platz haben, wirken wie ein Gegengewicht zur öffentlichen Bühne. In solchen Räumen darf das „Skript“ fallen.
- Mediennutzung reflektieren: Eine Unterscheidung zwischen Inhalten, die wirklich bedeutsam sind, und solchen, die vor allem der Selbstinszenierung dienen, kann bereits entlastend wirken.
- Eigene Werte klären: Wer weiß, wofür er:sie innerlich stehen möchte, kann bewusster entscheiden, welche Handlungen dazu passen – und welche eher der Rolle dienen.
- Professionelle Unterstützung nutzen: In Psychotherapie und Beratung lassen sich Spannungen zwischen Außenbild und Innenwelt bearbeiten. Themen wie Selbstwert, Bindungserfahrungen und Scham stehen dabei häufig im Zentrum.
Fazit: Zwischen Performance und innerer Stimmigkeit
Performativeness in sozialen Medien ist mehr als ein Trendwort. Der Begriff beschreibt ein weit verbreitetes Lebensgefühl in einer Welt, in der Sichtbarkeit, Markenbildung und ständige Vergleichbarkeit eine große Rolle spielen.
Zwischen dem Wunsch, gesehen zu werden, und dem Bedürfnis nach innerer Wahrheit entsteht eine Spannung, die direkt mit psychischer Gesundheit verbunden ist. Die entscheidende Frage ist weniger, ob überhaupt performed wird – das gehört zum sozialen Miteinander –, sondern wie groß der Abstand zwischen Rolle und innerem Erleben wird.
Wo dieser Abstand wächst, kann eine ehrliche Selbstreflexion hilfreich sein: Welche Lebensbereiche haben sich besonders in Richtung Selbstinszenierung verschoben? Wo braucht es wieder mehr Kontakt zu Unsicherheit, Verletzlichkeit und echter Freude – auch dann, wenn niemand zuschaut?
Wenn der Druck, eine Rolle zu spielen, dauerhaft zunimmt oder Leidensdruck entsteht, kann Unterstützung durch Fachpersonen – etwa Psychotherapeut:innen, Beratungsstellen oder seriöse digitale Angebote für psychische Gesundheit – dabei helfen, Performance und innere Stimmigkeit wieder behutsam zusammenzuführen.


