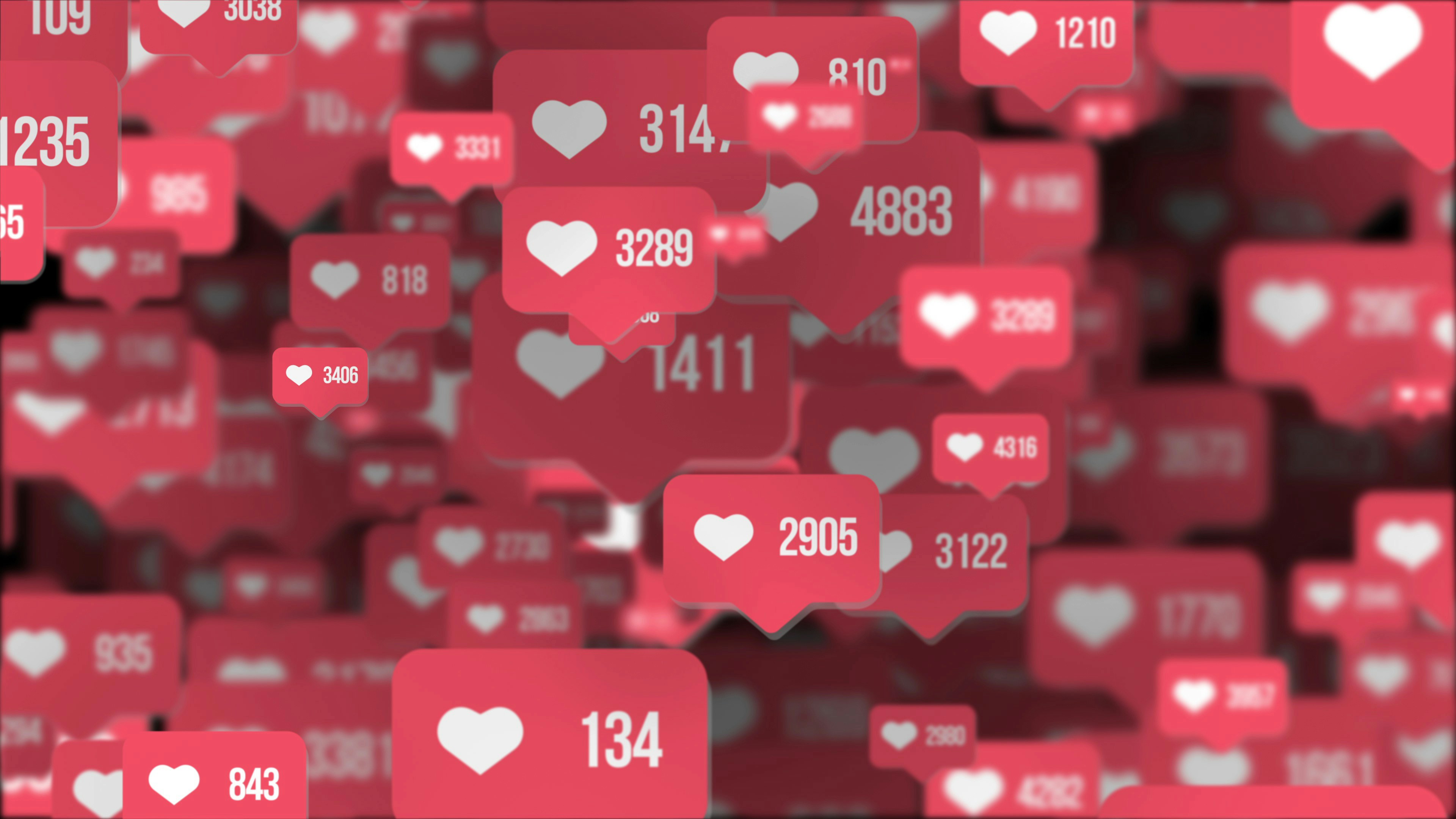Social Media und psychische Gesundheit: Chancen und Risiken
Fachlich geprüft von
Inês Lopes

Social Media und psychische Gesundheit sind längst auch ein politisches Thema. Australien zeigt gerade mit ihrem neuen Gesetz, dass es auf eine gesellschaftliche Regelung im Umgang mit Social Media setzt. Ab dem 10. Dezember 2025 dürfen Kinder und Jugendliche unter 16 offiziell keine eigenen Accounts mehr auf großen Plattformen wie TikTok, Instagram, Snapchat, YouTube, X oder Facebook haben. Die Unternehmen sind verpflichtet, wirksame Alterskontrollen einzuführen, sonst drohen hohe Geldstrafen. Auch die Europäische Union schaut sich diese Entwicklung genau an und hat bereits signalisiert, dass sie aus den Erfahrungen Australiens lernen will. In mehreren Ländern wird darüber diskutiert, ob strengere Altersgrenzen, Smartphone-Verbote an Schulen oder verpflichtende „Digital Detox“-Phasen notwendig sind, um Kinder und Jugendliche besser vor den Risiken sozialer Medien zu schützen.
Hinter all diesen politischen Maßnahmen steht eine gemeinsame Sorge: Die Nutzung von Social Media wird immer wieder mit Depressionen, Ängsten, Schlafstörungen und einem kritischen Selbstbild in Verbindung gebracht, besonders bei jungen Menschen. Gleichzeitig sind Apps wie TikTok, Instagram & Co. längst ein wichtiger Teil des Alltags, der sozialen Kontakte und auch der eigenen Identität geworden. Genau hier setzt die zentrale Frage dieses Artikels an: Was macht Social Media eigentlich mit deiner Psyche? Warum fühlt sich das Scrollen manchmal verbindend und inspirierend an und ein anderes Mal erschöpfend, unzufriedenstellend oder stressig? Und wie kannst du soziale Medien so nutzen, dass sie deiner psychischen Gesundheit möglichst wenig schaden und im besten Fall sogar zu einer Ressource für deine mentale Gesundheit werden?
Vergleich und Selbstwert: Wie Social Media sich auf dein Selbstwertgefühl auswirkt
Ein zentrales Thema im Zusammenhang von Social Media und psychischer Gesundheit ist der ständige Vergleich mit anderen. In Feeds tauchen perfekte Körper, aufwendig inszenierte Reisen und scheinbar makellose Karrieren auf. Dabei sind die meisten Inhalte stark kuratiert, bearbeitet und filtern all das heraus, was nicht in das gewünschte Bild passt oder die erhoffte Wirkung erzielt. Trotzdem wirken diese idealisierten Ausschnitte wie ein Maßstab, an dem sich viele Menschen unbewusst messen.
Gerade bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen gerät das Selbstwertgefühl ins Wanken, wenn das eigene Leben im Vergleich weniger aufregend, weniger erfolgreich oder weniger perfekt erscheint. Wer nach dem Scrollen häufiger das Gefühl hat, nicht zu genügen oder hinterherzuhinken, erlebt wie stark Social Media auf die Psyche wirken kann und wie schnell sich aus scheinbar harmlosen Vergleichen eine dauerhafte Unzufriedenheit entwickeln kann.
Doomscrolling und Dopamin-Kick: Wenn der Feed nicht mehr gut tut
Hinzu kommt ein Phänomen, das in den letzten Jahren immer mehr Aufmerksamkeit bekommt: Doomscrolling. Gemeint ist das scheinbar endlose Weiterscrollen durch negative Nachrichten, Krisenmeldungen und aufwühlende Kommentare - oft mit dem Vorsatz, nur kurz etwas nachzuschauen. Statt sich informiert zu fühlen, bleiben viele Menschen jedoch mit einem Gefühl von innerer Anspannung zurück. Je mehr sich der Feed mit Krisen, Konflikten und Katastrophen füllt, desto eher können Angst, Hilflosigkeit und das Empfinden entstehen, dass alles nur noch schlimm ist. Besonders weil auch der Algorithmus "feststellt”, dass dich diese Inhalte interessieren und dir zukünftig noch mehr dazu präsentiert. Also ein Teufelskreis.
Häufig passiert Doomscrolling abends oder nachts im Bett und somit genau dann, wenn das Gehirn eigentlich zur Ruhe kommen soll. Das blaue Licht des Bildschirms, kombiniert mit emotional belastenden Inhalten, erschwert das Einschlafen; Gedanken kreisen weiter, der Schlaf wird oberflächlicher, und am nächsten Tag fehlt die Energie. Doomscrolling zeigt sehr deutlich, wie unmittelbar sich digitales Verhalten auf psychische Gesundheit und körperliches Wohlbefinden auswirken kann.
Parallel dazu wirkt im Hintergrund das Belohnungssystem des Gehirns, der berühmte Dopamin-Kick, wenn du selbst auf Social Media aktiv bist. Jedes Like, jeder neue Follower und jeder Kommentar kann einen kleinen Dopaminschub auslösen. Das fühlt sich kurzfristig gut an und motiviert dazu, immer wieder zum Handy zu greifen, die eigenen Posts zu checken oder neue Inhalte zu veröffentlichen. Social Media wird so zu einer schnellen Quelle kleiner Glücksimpulse, die jedoch selten langfristig tragen.
Bleiben die erhofften Reaktionen aus, kippt die Stimmung leicht ins Gegenteil: Unsicherheit, Selbstzweifel oder Frust machen sich breit. Einige Forschungen legen nahe, dass Social Media bei einem Teil der Nutzer:innen ein suchtförmiges Verhalten begünstigen kann, vergleichbar mit anderen Verhaltenssüchten, bei denen der nächste „Kick“ immer nur einen Klick entfernt ist. Auch hier wird deutlich: Es geht nicht nur darum, wie viel Zeit online verbracht wird, sondern wie Social Media konsumiert wird und welche Rolle diese Mechanismen für Selbstwertgefühl, mentale Gesundheit und emotionale Stabilität spielen.
Was Studien zu Social Media und psychischer Gesundheit zeigen
Aus wissenschaftlicher Perspektive zeichnet sich ein differenziertes Bild von Social Media und mentaler Gesundheit. Verschiedene Studien deuten darauf hin, dass exzessive oder unreflektierte Nutzung sozialer Medien mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit für depressive Symptome, Angststörungen und Schlafprobleme einhergeht. Besonders die späte Nutzung am Abend kann die Melatoninproduktion stören und zu Ein- oder Durchschlafproblemen führen, was sich wiederum direkt auf Stimmung, Konzentrationsfähigkeit und Stressresistenz auswirkt.
Cybermobbing, abwertende Kommentare oder Ausgrenzung in Chats und Kommentarspalten können das psychische Wohlbefinden zusätzlich belasten. Wer wiederholt negative Rückmeldungen oder Angriffe erlebt, kann sich zurückziehen, mehr Scham empfinden oder sich sozial isoliert fühlen. Wichtig ist dabei jedoch zu wissen, dass Social Media meist nicht die alleinige Ursache psychischer Erkrankungen ist. Häufig verstärken digitale Medien bestehende Belastungen oder machen sie sichtbarer. Für die Beurteilung der Auswirkungen von Social Media auf die Psyche ist daher entscheidend, wie intensiv, in welcher emotionalen Verfassung und mit welchen Inhalten soziale Netzwerke genutzt werden.
Wenn Social Media zur Ressource für mentale Gesundheit wird
Gleichzeitig wäre es zu kurz gegriffen, Social Media nur als Risiko für die psychische Gesundheit zu sehen. Viele Menschen erleben soziale Netzwerke als Quelle von Inspiration, Information und Verbundenheit. Wer in seinem direkten Umfeld wenig Verständnis für bestimmte Themen findet, kann online Menschen treffen, die ähnliche Erfahrungen machen, etwa bei chronischen Erkrankungen, in der queeren Community oder im Kontext psychischer Belastungen.
Gerade im Bereich mentale Gesundheit gibt es zahlreiche Accounts, die niedrigschwellig Informationen zur Verfügung stellen, Tipps für den Alltag geben oder Betroffenen das Gefühl vermitteln, nicht allein zu sein. Humorvolle Inhalte, kreative Videos oder lehrreiche Beiträge können die Stimmung heben, den Horizont erweitern und im besten Fall dazu beitragen, sich selbst besser zu verstehen. Social Media kann dann zu einem Ort werden, an dem Austausch, Solidarität und gegenseitige Unterstützung entstehen, ein Gegenpol zum Vergleichsdruck und Doomscrolling.
Gesunder Umgang mit Social Media: Kleine Schritte, große Wirkung
Entscheidend für eine gesunde Beziehung zu Social Media und psychischer Gesundheit ist ein bewusster Umgang. Es kann helfen, die eigene Bildschirmzeit zu beobachten und sich zu fragen, wie es sich vor, während und nach dem Scrollen anfühlt. Wenn deutlich wird, dass bestimmte Inhalte immer wieder herunterziehen, ist es vollkommen legitim, Accounts zu entfolgen oder zu stummschalten und stattdessen Profilen zu folgen, die stärken oder inspirieren.
Auch kleine Routinen können unterstützen: zum Beispiel abends eine feste Zeit, ab der das Handy nicht mehr im Bett liegt, oder bestimmte Tage, an denen Social Media bewusst nur in kurzen, definierten Phasen genutzt wird. Genauso wichtig ist es, das Offline-Leben aktiv zu pflegen. Treffen mit Freund:innen, gemeinsame Aktivitäten, Bewegung an der frischen Luft oder Hobbys, die nichts mit dem Bildschirm zu tun haben, können einen stabilisierenden Gegenpol zur digitalen Welt bilden und die mentale Gesundheit stärken.
Wer merkt, dass Doomscrolling, Vergleichsdruck oder ständige Verfügbarkeit zur Belastung werden, darf diese Signale ernst nehmen. Social Media muss sich an das eigene Leben anpassen und nicht umgekehrt.
Fazit: Bewusster Umgang mit Social Media und Psyche
Am Ende ist Social Media weder per se gut noch per se schlecht. Soziale Netzwerke können verbinden, informieren und neue Perspektiven eröffnen; sie können aber auch Vergleichsdruck erzeugen, Doomscrolling fördern, den Schlaf stören und das Selbstwertgefühl ins Wanken bringen. Die Auswirkungen von Social Media auf die psychische Gesundheit hängen stark davon ab, wie bewusst, wie häufig und mit welchen Inhalten die Plattformen genutzt werden.
Indem Menschen ihre Nutzung reflektieren, innere und äußere Grenzen definieren und auf die Signale ihrer psychischen Gesundheit achten, können sie Einfluss darauf nehmen, welche Rolle Social Media im eigenen Leben spielt. Wenn der Eindruck entsteht, dass Social Media stark belastet, die Stimmung dauerhaft gedrückt ist oder Sorgen um die eigene mentale Gesundheit wachsen, kann es sinnvoll sein, professionelle Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Je früher Belastungen erkannt werden, desto besser kann darauf reagiert werden, auch mit Hilfe digitaler psychologischer Diagnostik, die dabei unterstützt, Symptome frühzeitig sichtbar zu machen und passende Hilfsangebote zu finden.
Vielleicht ist es genau jetzt ein guter Moment, die eigene Social-Media-Nutzung einmal ehrlich zu betrachten und kleine Veränderungen auszuprobieren.